Aufgaben & Ziele
An der KHSB bündeln wir unsere Expertise im Bereich Gender und Diversity, um Lebenslagen benachteiligter Menschen sichtbar zu machen, soziale Ausgrenzung zu hinterfragen und gerechtere Handlungsperspektiven in der Sozialen Arbeit zu entwickeln. Durch interdisziplinäre Forschung, Lehre und Praxis setzen wir uns für Teilhabe, Gleichstellung und eine reflexive Fachkräftebildung ein.
Aufgabenfelder des Instituts
Die Forschungskompetenzen an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin im Bereich Gender und Diversity werden durch die Zusammenarbeit im Institut gebündelt, verbreitet und produktiv gemacht. Teilhabebezogene und formative Untersuchungen im Feld der Gender-, Queer-, Migrations-, und Diversityforschung ermöglichen, die Lebenslagen von benachteiligten und ausgegrenzten Menschen besser zu verstehen und sichtbar zu machen. Es werden Entwicklungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene und ältere Menschen gesucht und sozialpolitische und pädagogische Handlungsansätze zu ihrer Unterstützung und Stärkung aufgezeigt bzw. evaluiert. Dadurch wird nicht nur ein Beitrag zur Verbesserung von Lebensverhältnissen der Adressat*innen geleistet, sondern auch eine Entwicklung von Gender- und Diversitykompetenzen von (angehenden) Fachkräften, in den Institutionen sozialer Praxis und der Wissenschaft unterstützt.
Das Institut macht sich zudem zur Aufgabe, den institutsinternen Austausch über die Integration der Themen Gender und Diversity in weitere Diskussionen der eigenen und der anderer Hochschulen hineinzutragen und gleichstellungsfördernde Anstöße zu geben, beispielsweise mit der Weiterentwicklung von Gleichstellungskonzepten und -maßnahmen und einer gender- und diversitybewussten Studiengangs- und Lehrplanung.
Zielsetzung des Instituts
Insbesondere in einer Großstadt wie Berlin hat sich eine Vielfalt von sozialen Positionierungen, Lebensweisen, Ungleichheitslinien und Lebensbewältigungsmustern ausdifferenziert. Diese stellen Menschen Möglichkeiten und Ressourcen zur selbstbestimmten Gestaltung ihres Lebens bereit.
Sie begründen aber dennoch häufig auch Normierungen, Benachteiligungen und Ausgrenzungen. Eine behindernde Rolle für Inklusion spielen gruppenbezogene Stigmatisierungen: Zuschreibungen von vermeintlich „natürlichen“ Merkmalen gemäß der ethnischen und sozialen Herkunft, des Alters, der Geschlechtsidentitäten und sexuellen Orientierungen, des sozio-ökonomischen Status, der religiösen Zugehörigkeit oder der Weltanschauung sowie Zuschreibungen von körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen und Behinderungen. Entlang dieser Differenzlinien produzieren rechtliche, ökonomische und politische Diskriminierungen Ungleichheit.
Soziale Arbeit als Disziplin und Profession ist gefordert, Vielfalt und Ausgrenzung durch reflexive professionelle Selbstaufklärung, aber auch durch intersektionale sozialpolitische und -pädagogische Programme aufzugreifen und für ein Mehr an sozialer Gerechtigkeit einzutreten. Zu diesem Ziel tragen gender- und diversitätsbewusste Forschungs- und Praxisansätze als wesentliche Querschnittsaufgaben in der Sozialen Arbeit bei.
Unser Verständnis von Gender und Diversity
Soziale Ungleichheit, Ein- und Ausschlüsse sowie Diskriminierungen sind mehrdimensional und machtbasiert. Sie stellen die Folge von vielschichtigen Normierungen entlang sozialer Kategorien dar. Empirische Forschungen zu Gender und Diversity und Forschungen zur Verwobenheit von Dimensionen sozialer Ungleichheit stellen ein kritisches Wissen bereit, um zu beschreiben und zu analysieren, wie diese entstehen und verändert werden können. Damit wird die Entwicklung von machtkritischen Haltungen zu Prozessen des „doing gender”, „doing ethnicity und “doing difference”ermöglicht.
Ziele in Forschung und Lehre sind, kritisch-reflexive Einstellungen, Handlungsweisen und Konzepte in Hinblick auf faktische Ungleichheiten und soziale Konstruktionen von Gender- und Diversity zu entwickeln.
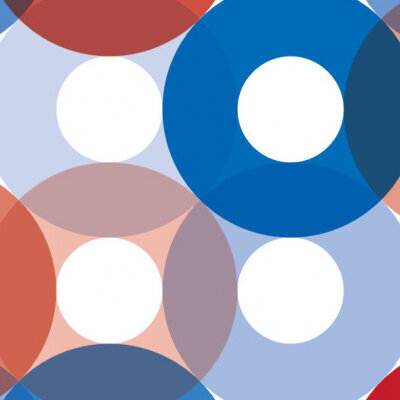
Im Rahmen des Instituts vertreten wir ein ganzheitliches und (re-)politisiertes Diversity-Konzept, das Geschlecht, Sozialstatus, natio-ethno-kulturelle Zugehörigkeit und (Dis-)Ability als sozial konstruierte Kategorien berücksichtigt.
Im Rahmen eines intersektionalen Diversity-Konzeptes betonen wir aufgrund der Entstehungsgeschichten in sozialen Bewegungen und Positionierungen von Akteur*innen die Bedeutung feministischer und geschlechterpolitischer Ansätze durch die Aufrechterhaltung des Terminus Gender.