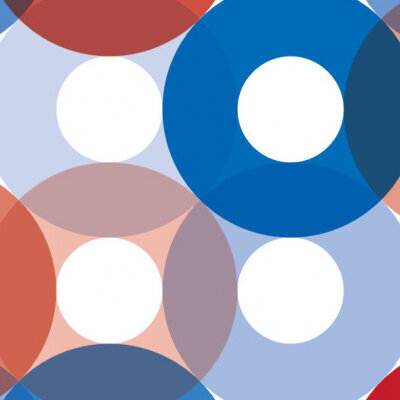Aktivitäten des Instituts
Das Institut für Gender und Diversity zeigt sich nicht nur durch seine Forschungsergebnisse, sondern auch durch vielfältige Aktivitäten zu den Themen Gender und Diversity, beispielsweise an der Hochschule oder im Berufsverband Soziale Arbeit.
Mitgliedschaften und Kooperationen
Klischeefrei
Die Initiative Klischeefrei setzt sich dafür ein, dass junge Menschen sich bei der Wahl ihres Berufs oder Studiums nicht von Geschlechterrollen beeinflussen lassen. Ziel ist es, ihnen vielfältige Perspektiven zu eröffnen, damit sie einen Weg einschlagen können, der zu ihrer persönlichen Identität und ihren Lebenszielen passt.

Arbeitsgemeinschaft der frauen- und geschlechterforschungseinrichtungen Berliner Hochschulen (afg)
Die afg ist als Kompetenznetzwerk gegründet worden, um Potenziale an Berliner Hochschulen zu bündeln, besser zu koordinieren und dezentrale Strukturen zu stärken. Die vertretenen Einrichtungen der Frauen- und Geschlechterforschung arbeiten sowohl innerhalb einzelner Disziplinen als auch interdisziplinär. Durch die Arbeitsgemeinschaft können sie ihre Aktivitäten gezielt abstimmen, verstärken und weiterentwickeln.
Forschungs- und Entwicklungsprojekt im Berufsfeld Kita & Ganztag
Beratung,- und Informationsstelle für Fachkräfte für Kitas und Ganztag an Grundschulen.
NEU: - Der Kompass Erziehungsberufe übersetzt und bündelt unter anderem Gesetztestexte und Verordnungen zu allen Fachkräfteangeboten in Grundschulen und Ganztagbetreuungen. -
Michael Cremers Dissertationsprojekt am Institut: - Kindheit als umkämpfte Ordnungsfigur – Eine differenzsensible und machtreflexive Analyse subjektivierender Adressierungspraxen in Kindertageseinrichtungenä -
Die Dissertation analysiert Kindheit als eine institutionell strukturierte, pädagogisch regierbare und gesellschaftlich umkämpfte Ordnungsfigur. Auf Basis einer ethnographischen Feldforschung in zwei Kindertageseinrichtungen werden alltägliche Adressierungspraktiken rekonstruiert, durch die Kinder als bestimmte Subjekte positioniert werden. Im Zentrum steht eine sechsdimensionale Typologie pädagogischer Anerkennungs- und Adressierungsmodi. Theoretisch basiert das Projekt auf gouvernementalitätstheoretische, differenz- und subjektivierungstheoretische Zugänge. Kindheit erscheint dabei als Spannungsfeld zwischen Normalisierung, Differenzproduktion und widerständiger Re-Adressierung.